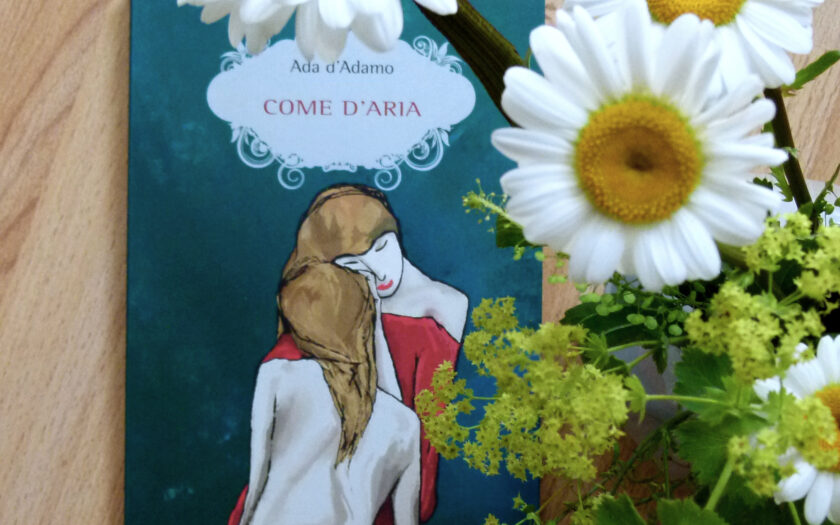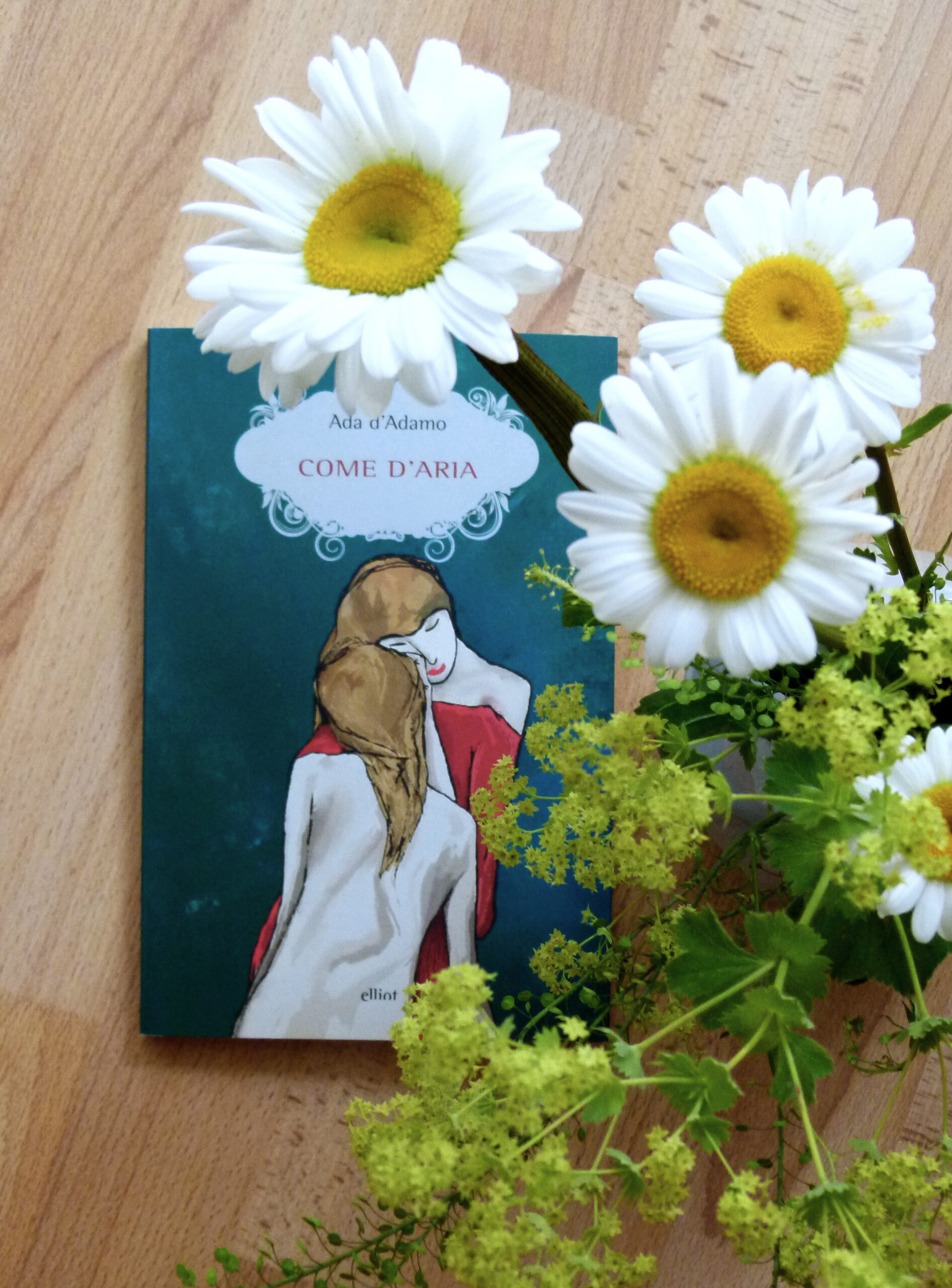Brief an mein Kind – Ada D’Adamo
Verlag: Eisele Verlag | Seiten: 192 Originaltitel: Come D’Aria | Übersetzer*in: Karin Krieger Erscheinungsjahr: 2024 |
Kurzbeschreibung
Daria ist Adas schwerbehinderte Tochter, deren Behinderung bei den vorgeburtlichen Untersuchungen übersehen wurde. Erst nach der Geburt wird die Diagnose gestellt: Daria ist schwerbehindert – körperlich wie mental. Als Ada mit knapp 50 Jahren die Nachricht erhält, dass sie selbst an Krebs erkrankt ist und zum Pflegefall wird, fühlt sie sich ihrer Tochter so nah wie noch nie zuvor.
Meine Meinung
„Brief an mein Kind“ ist eine sehr intime und persönliche Rück- und Innenschau einer schwerkranken Mutter, die dem Tod unweigerlich entgegenblickt. Die Autorin rekapituliert in diesem autobiografischen Roman ihre Beziehung zu ihrer schwerbehinderten Tochter und führt sich und den Leser*innen das eigene Schicksal vor die Augen und durchs Herz.
Der autobiografische Roman nimmt dabei die Form eines einseitigen Briefromans an, in dem die Autorin sich tagebuchartig an ihre Tochter wendet und ihre beiden Geschichten erzählt. Dabei folgt die Autorin keiner linearen oder chronologischen Reihenfolge: Es ist ein Aufeinanderfolgen und ein Sich-Verflechten von Erinnerungen, Assoziationen, Gefühlen und Eindrücken aus der Gegenwart und der Vergangenheit.
Zwar hat mich das Geschriebene nicht zu Tränen gerührt (dafür war der Ton mMn viel zu erhaben), doch hat es mich auch nicht kalt gelassen. Vor allem, dass Daria und ich uns ein Geburtsdatum teilen, hat das ganze Geschehen sehr nah herangeholt. Aber eine gewisse Distanz, die ich auch nicht überbrücken wollte, blieb bestehen.
Blickt die Autorin in ihr Inneres hinein, dann wird man von einer Ehrlichkeit überrascht, die einem fast schon brutal erscheint — man muss dabei auch immer im Hinterkopf behalten, dass man als Leser*in nicht weiß, was tatsächlich der Wahrheit entspricht und wie viel die Autorin fiktionalisiert hat. Dennoch hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Privatsphäre der Tochter, die selbst keine Stimme hat, ein bisschen zu sehr überschritten wird. Es geht nicht nur um die alltäglichen Schwierigkeiten, die sich bei der Versorgung von Daria ergeben, wie die abwertenden und abweisenden Blicke von Fremden, die Hürden der Integration an Schulen, die mangelnde Unterstützung und vor allem die fehlende medizinische Aufklärung nach der Geburt, sondern es geht auch um die Periode ihrer Tochter oder um einen gescheiterten Abtreibungsversuch in Eigenregie. Absichtlicher Tabubruch, um das Unsagbare sagbar zu machen? Oder sucht die Autorin nach einer Art Absolution? Ich weiß es nicht. Bei mir haben diese Schilderungen eher Unbehagen ausgelöst.
Doch auch ihre eigene Privatsphäre durchlöchert Ada d’Adamo: Sie beschreibt, wie es sich anfühlt, selbst zum Pflegefall zu werden und welche Nähe bzw. Entfernung zwischen ihr und ihrer Tochter dadurch entstanden ist. Es geht vielfach um den Verlust eines alten Lebens und um ungewollte Selbstaufgabe. Nur selten blinzeln die positiven Aspekte des Lebens zwischen den Zeilen hervor. Das macht die Lektüre teilweise arg beschwerlich.
Das Geschriebene regt zum Nachdenken an, z. B. wenn die Autorin von „schönen“ und „hässlichen“ Behinderungen spricht. Die Autorin erklärt, dass die Schönheit ihrer Tochter Fluch und Segen zugleich sei: Einerseits wurden bei den Voruntersuchungen keine Fehlbildungen entdeckt (Fluch), andererseits haben Therapeut*innen und Ärzte*Ärztinnen weniger Berührungsängste und zeigen im Umgang mit Daria weniger Unbehagen; denn Daria ist so schön, dass ihr Äußeres manchmal ihre Behinderung verblassen lässt (Segen). Inwiefern manche Aussagen der Autorin ableistisch sind, kann ich nicht einschätzen.
Die Autorin kommt immer wieder auf das Tanzen zurück und auf die Schönheit und Grazie, die das Tanzen mit sich bringt. Das Tanzen hat sie nicht nur auf beruflicher Ebene geprägt, sondern es fungiert auch als Brille auf die Welt und auf ihren und auf den Körper ihrer Tochter. Die Autorin betont, wie wichtig das eigene Körpergefühl ist und wie entscheidend es ist, zärtlich mit dem eigenen Körper umzugehen, der so viel für uns leistet. Wie gern mäkeln wir an ihm herum, bis es dann zu spät ist. Als Kontrastprogramm zum Tanz und zur Körperkontrolle, beschreibt die Autorin die epileptischen Anfälle, Krämpfe und Paresen ihrer Tochter.
Auch der Schreibstil lässt sich als tänzerisch beschreiben: Die Autorin ist darauf bedacht, sich gewählt, ausdrucksstark und zuweilen poetisch auszudrücken. Mal eindeutig und verständlich, mal erhaben und übertrieben. Ich möchte nicht sagen, dass die Autorin sich geschwollen ausdrückt, aber hier und da kam mir das Geschriebene schon sehr bauschig-bildhaft vor.
Diesen Roman zu bewerten, ist mir sehr schwer gefallen, weil der Tod der Autorin noch nicht lange zurückliegt. Ada D’Adamo verstarb am 1. April 2023 nach langer Krankheit und der Roman wurde posthum mit dem renommierten Literaturpreis „Premio Strega“ ausgezeichnet.
Mein Fazit
„Brief an mein Kind“ von Ada D’Adamo ist ein außergewöhnlicher und eindrucksvoller autobiografischer Roman (wohl mit fiktionalisierten Einschüben?), in dem die Autorin ihrer Tochter und der Nachwelt alles sagt, was ihr auf dem Herzen liegt und auf den Schultern lastet. Der Roman handelt von Liebe, Verlust, unmöglichen Entscheidungen, von Scham, Reue und innerer wie äußerer Stärke. Es ist keine Lektüre für zwischendurch, sondern man muss Ada und ihrer Tochter sehr viel Platz im Kopf und im Herzen einräumen.