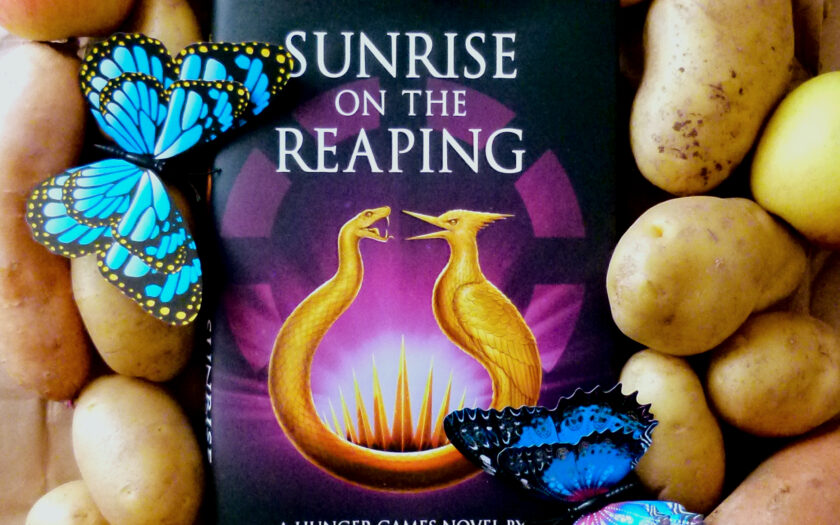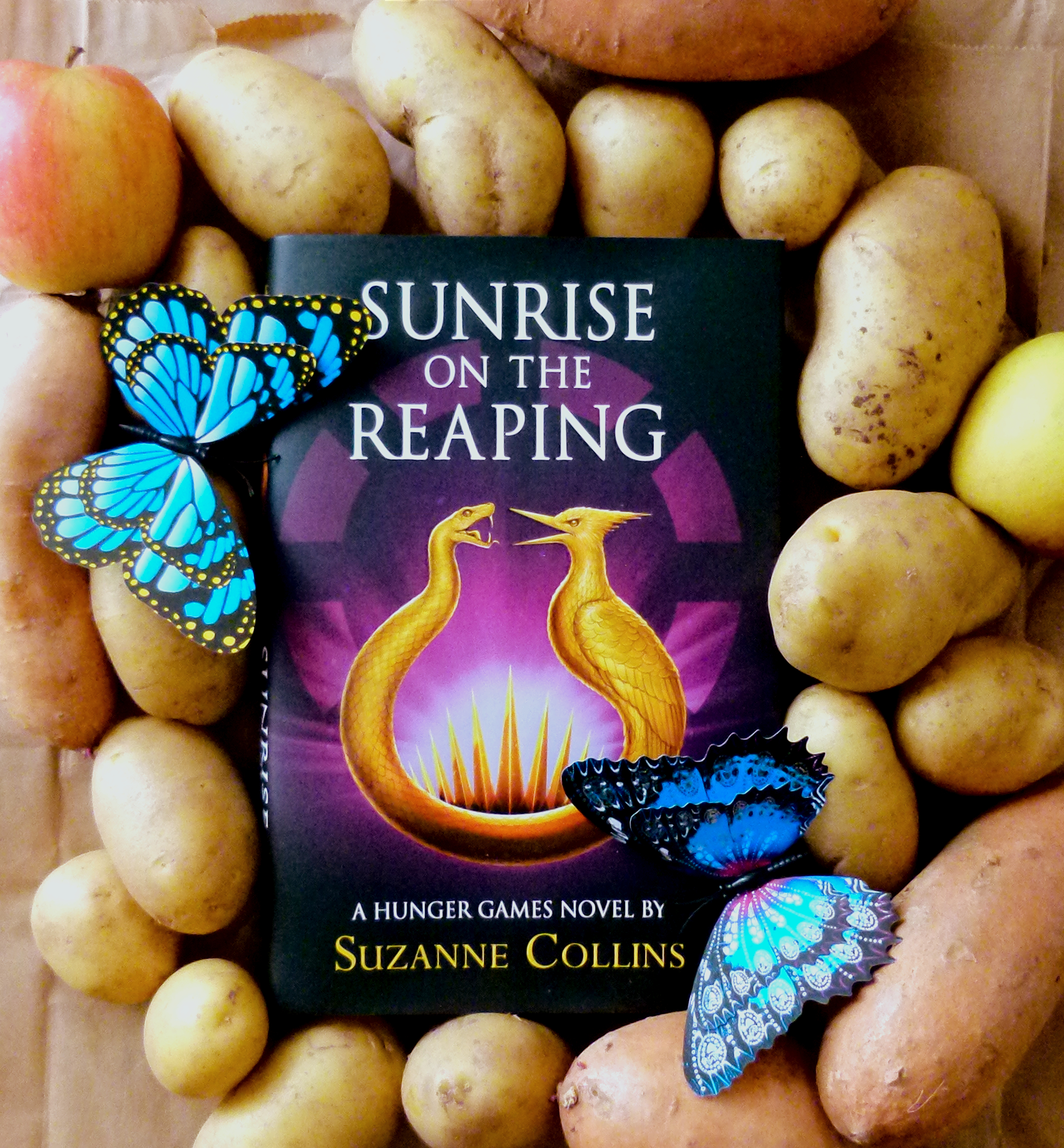Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an – Suzanne Collins
Verlag: Verlagsgruppe Oetinger | Seiten: 464 Originaltitel: Sunrise On The Reaping | Übersetzer*innen: Sylke Hachmeister, Peter Klöss Erscheinungsjahr: 2025 |
Kurzbeschreibung
Als Haymitch Abernathy in Distrikt 12 am Tag seines 16. Geburtstags erwacht, bricht auch der Tag der Ernte zu Panems 50. Hungerspielen an. Doppelt so viele Tribute wie sonst werden dieses Jahr ausgewählt und müssen sich gegenseitig bekämpfen. Als Haymitchs Name aufgerufen wird, wird er aus den Armen seiner Familie und seiner großen Liebe Lenore Dove gerissen. Auf dem Weg in die Arena muss sich Haymitch eingestehen, dass er nicht mit dem Leben davonkommen wird – doch er will kämpfen, wenn nicht für sich, dann für etwas weitaus Größeres und Bedeutenderes.
Meine Meinung
Ich kann durchaus verstehen, dass man versucht ist, diesen Roman aus Nostalgie-Gründen hoch zu bewerten. Aber ich frage mich, ob dieser Roman wirklich „großartig“ und „das beste Buch der Reihe“ ist? Ja, der Roman war ganz gut, aber die Geschichte um Haymitch und die 50. Hungerspiele haben mich weniger mitgerissen als erwartet. Der neue Roman kommt bei Weitem nicht an Katniss‘ Geschichte heran (und auch nicht an Snows Geschichte) – dafür bringt der Roman zu wenig Neues auf den Tisch. Das gilt für die Figuren, ihre Konstellationen und Dynamiken, die Motive und die Handlung an sich.
Dass Haymitch die 50. Hungerspiele überlebt, wussten wir. Wie er überlebt, was alles in der Arena, in der Zeit davor und danach geschieht, das wussten wir nicht – bis jetzt, denn genau diese Ereignisse stehen in diesem Roman im Vordergrund. Die Autorin musste also einen bekannten Ausgang auf eine spannende und wenig vorhersehbare Weise verpacken. So ganz ist ihr das leider nicht gelungen.
Der Roman teilt sich in drei Teile auf, die genau diese zeitlichen Abschnitte behandeln: vor, während und nach den Spielen. Der erste Teil umfasst den Zeitraum zwischen Tag der Ernte und dem Eintritt in die Arena. In diesem Zeitraum wartet die Autorin wirklich mit einigen herzzerreißenden und abscheulichen Wendepunkten und Überraschungen auf. Wenn man aufmerksam liest, dann findet man viele vorausweisende Elemente, die einen voller Anspannung und Erwartungen auf den Arenaplot blicken lassen.
Doch es sollte anders kommen als erwartet: Der Arenaplot hat mich (zu meinem eigenen Bedauern) unschlüssig zurückgelassen – nein, eigentlich bin ich enttäuscht. So schmälernd es klingt, aber mMn war es eine Mischung (Abklatsch wäre zu hart) aus den ersten beiden Büchern der Trilogie – „The Hunger Games“ und „Catching Fire“ – nur mit doppelt so vielen Tributen und einem tragischen Ende – denn was aus Haymitch wird, wissen wir alle. Nicht alle Details des Arenaplots greifen logisch ineinander. Ich musste mich schon sehr zusammenreißen, nicht genervt und ungläubig das Buch wegzulegen.
Die doppelte Anzahl der Tribute hatte keinerlei Auswirkungen auf den Spannungsbogen des Arenaplots – ich sag’s, wie es ist. Ich betone das, weil dieser Umstand in den Fokus gestellt wird und viel Aufsehen darum gemacht wird. Aber 48 Tribute bleiben ohne Konsequenz für die Handlung. Es ist nur ein Schockelement.
Man folgt Haymitch durch die Arena und so bekommt man vom Kämpfen und Sterben der anderen Tribute, deren Bedeutung im ersten Teil des Buches so stark hervorgehoben wird, so gut wie nichts mit. Das war enttäuschend und ließ den Spannungsbogen durchhängen. Im ersten Teil des Romans hängt man sein Herz vielleicht an die eine oder andere Figur, nur um dann herauszufinden, dass diese Figur überhaupt keine Rolle mehr spielt. Die vorgestellten Figuren waren alle nur ein erzählerisches Mittel zum Zweck und das war frustrierend.
Den wenigen Tribute, denen man in der Arena dann doch begegnet, erhalten nicht den Raum, den sie eigentlich verdient hätten. Man trifft sie eigentlich nur, um ihnen beim Sterben zuzusehen. Und das ließ diese unnötigen, grausamen und wirklich schrecklichen Tode lahm erscheinen – und das klingt irgendwie herzlos, ich weiß. Auch die Trauer um diese Tribute kam viel zu kurz – die Autorin gibt Haymitch nicht die Zeit sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, was vielleicht zu seiner Figur passen mag, den Leser*innen damit aber nicht die Möglichkeit gibt, die Gewalt zu verarbeiten. Auch das ist wohl Absicht, aber es hat einen sehr bitter-faulen Beigeschmack. Am meisten bedauere ich den Umgang mit Maysilee Donner. Der glänzende Aufstieg dieser Figur in die Herzen der Leser*innen steht im krassen Gegensatz zu ihrem Ende.
Haymitch ist mir, um ganz ehrlich zu sein, von Anfang an auf die Nerven gegangen – besonders aber ab der Mitte bis zum Ende des Romans hin, fand ich sein Verhalten und die Einblicke in sein Denken wirklich anstrengend. Dass das unfair ihm gegenüber ist, muss man mir nicht sagen. Dabei ist es nur konsequent, weil ich ihn schon in der Hauptreihe nicht mochte. Wenn ich nun allerdings bedenke, was man in diesem Roman über ihn erfährt, dann schäme ich mich fast schon für meine Reaktion, an der sich aber trotzdem nichts ändern lässt.
Ich empfinde einfach eine große Entfernung zu ihm: Er ist nicht platt oder eindimensional, aber irgendwie zu glatt, anbiedernd, darufgängerisch und wird zu sehr auf Liebling getrimmt. Mehrmals im Verlauf der Handlung habe ich mich gefragt, warum er nicht innehält und gewisse Dinge hinterfragt. Der Fokus lag zu sehr auf Aktion und Reaktion und zu wenig auf innerer Konfliktbetrachtung und innerem Wachstum.
Haymitchs Liebe zu Lenore Dove ist ein wichtiger Teil seiner Figur, der künstlich aufgebläht wird. Als Leserin bekam ich das Gefühl, Lenore Dove mögen zu müssen und dieser Zwang wurde mir auf gefühlt jeder dritten Seite unter die Nase gerieben. Dabei erfahren wir so wenig über Lenore Dove; man kann sich kaum einiges Bild von dieser Figur machen, die offenbar eine faszinierende Familiengeschichte mit sich bringt. Ich kann es nicht leiden, wenn man mir auf wenig subtile Art und Weise zu verstehen gibt, welche Figur ich mögen sollen und welche nicht.
Haymitchs Heimkehr und auch die darauffolgenden Ereignisse waren schmerzhaft, bitte versteht das nicht falsch, aber irgendwie fiel das alles flach aus. Ich konnte den Schmerz sehen, habe mitgefühlt, aber der Schmerz war nicht tiefempfunden. Der Epilog hat mir am Schluss den Rest gegeben: zu viele Fingerzeige, viel zu viel erzwungene Sentimentalität und emotionale Manipulation.
Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, warum mich der Roman, die Figuren und die Handlung nicht auf einer tieferen Ebene erreicht haben. Zum einen befürchte ich, dass ich mit 32 Jahren einfach zu alt für einen Young Adult-Roman geworden bin. Und zum anderen konnten mich die Unmenschlichkeit, die Brutalität und die Kalkuliertheit des Kapitols einfach nicht mehr überraschen. Auch die frappierenden Ähnllichkeiten zwischen Katniss‘ und Haymitchs Arenaplot waren einfach zu deutlich. Alles wirkte altbekannt und durchgekaut. Nach vier Romanen weiß ich einfach zu viel über das Kapitol, um da noch so richtig geschockt zu sein. Und den Figuren mangelt es eben genau an diesem Wissen. Ich denke, dass eben dieses Gefälle für eine zu starke Entrückung sorgte. Es fiel mir immens schwer, einfach so über die Naivität der Figuren hinwegzusehen.
Auch werde ich das Gefühl nicht los, dass die Erzählung den Leser*innen zu sehr vorgibt, wie sie zu reagieren haben. Das Erzählte ermöglichte es nicht, die Reaktionen aus sich selbst entspringen zu lassen. Es heißt ja nicht umsonst: Show, don’t tell!
Haymitchs Vorgeschichte gibt Aufschluss darüber, warum die Figuren um Katniss so handeln, wie sie handeln. Die Romanhandlung erklärt, wie es zu den Ereignissen im zweiten Band „Catching Fire“ kommt. Haymitchs Geschichte ist die Zündschnur, die in Katniss Geschichte Feuer fängt und das Kapitol verbrennt.
Eine Frage, die ich mir während der Lektüre immer wieder gestellt habe, war: Wie viel der Handlung stand schon beim Erscheinen der Hauptreihe fest und was davon wurde im Nachhinein daraufgesetzt und passend gemacht? Mich haben die Plausibilität und das reibungslose Ineinandergreifen einiger Handlungsstränge nicht wirklich gestört, auch wenn es teilweise sehr offensichtlich war, dass etwas zu gut passt. Auch die Begegnungen mit (zu vielen) altbekannten Figuren waren fast schon ein bisschen zu viel des Guten.
Die Moral von der Geschicht? Ich sehe da kaum einen Unterschied zu den anderen Teilen der Reihe. Suzanne Collins zeigt wieder wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu erzählen, Propaganda und Manipulation zu hinterfragen, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und fest an der eigenen Menschlichkeit und den eigenen Überzeugungen festzuhalten. Leider wird ein Teil dieser Botschaft in diesem Roman von einigen Figuren fast mantramäßig wiederholt. So wird es den Leser*innen auf einem Silbertablett unter die Nase gehalten, dass man der Angelegenheit fast überdrüssig wird.
Mein Fazit
„L. Der Tag bricht an“ von Suzanne Collins erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathy, einem Publikumsliebling – nicht nur des Kapitols. Die Autorin zeigt abermals, dass die „Formel“ der Hungerspiele funktioniert und treibt sie in Haymitchs Geschichte auf die Spitze. Nostalgie spielt bei der Bewertung dieses Romans sicherlich eine große Rolle. Ich würde den Roman weder als „überragend“ noch als „Meisterwerk“ betiteln. Es ist nicht die geniale Vorgeschichte, die ich mir erhofft hatte, sondern wärmt vieles wieder auf, was wir schon kennen.