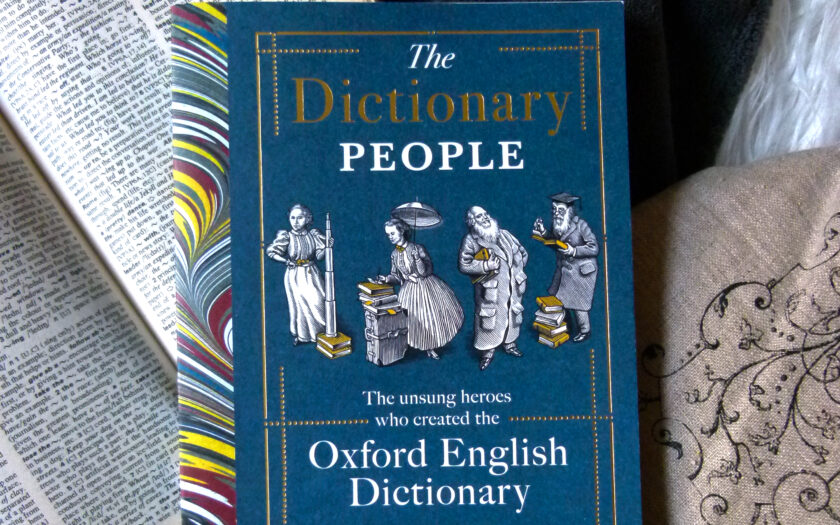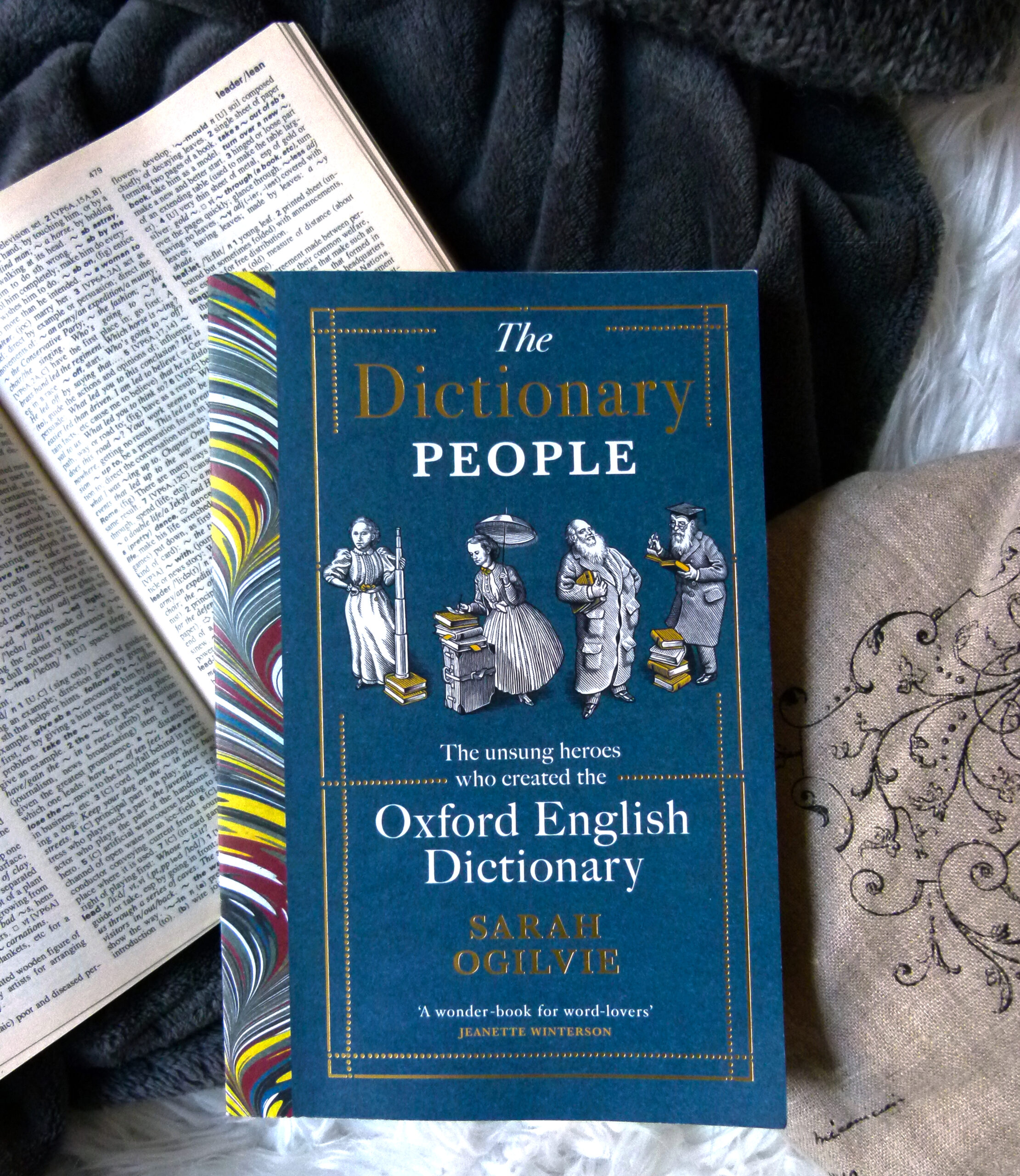The Dictionary People – Sarah Ogilvie
Verlag: Knopf | Seiten: 384 Erscheinungsjahr: 2023 |
Kurzbeschreibung
Im Jahr 2014 fand Sarah Ogilvie bei ihrem Abschiedsbesuch in den vergessenen Untiefen der Wörterbucharchive des OED (Oxford English Dictionary) ein Adressbuch von James Murray, in dem er minutiös die Namen und Adressen eines jeden Freiwilligen notiert hatte, die für das Wörterbuch Wörter und Zitate gesammelt und so einen großen Beitrag zum Wörterbuchprojekt geleistet hatten. Die Autorin nutzte diesen Schatz, um nach den Personen zu suchen, die hinter den Namen stecken. Das Ergebnis ihrer langjährigen Nachforschungen hielt sie in diesem Buch fest: Mit „Dictionary People“ setzt Sarah Ogilvie all den unbekannten Freiwilligen ein Denkmal und holt sie aus den verstaubten Ecken von Bibliotheken und Archiven in unsere Mitte.
Meine Meinung
Das Oxford English Dictionary (kurz: OED) gilt als das bedeutendste Wörterbuch der englischen Sprache. Seinen Anfang nahm das Projekt 1857 und im Jahr 1884 erschien die erste Lieferung unter der Leitung von James Murray. Das Besondere an diesem Wörterbuch ist nicht etwa, dass bekannte Autoren wie J. R. R. Tolkien an dem Wörterbuch mitgewirkt haben, sondern dass es das Wörterbuch ohne die Mithilfe von unzähligen Freiwilligen in der uns heute bekannten Form wahrscheinlich nicht geben würde. Diese Freiwilligen sammelten unzählige Wörter und Zitate, die die Basis des OED wurden. Zu diesen Freiwilligen zählen nicht nur Experten der britischen, akademischen Elite, sondern auch Personen, die ihr Leben weit entfernt von diesen Gefilden führten: Frauen, queere Personen, Vegetarier, Mörder oder Pornographiesammler.
Studiert man Lexikographie kommt man nicht umhin, sich mit dem Oxford English Dictionary, seiner Geschichte und seiner Bedeutung auseinanderzusetzen. Das OED ist das Wörterbuchprojekt schlechthin, es ist ein Monument, es ist das Vorzeigewerk der englischen Sprache. Und vor allem in den letzten Jahren ist es in der Popkultur immer weiter in den Vordergrund getreten, wie zB das Sachbuch und der gleichnamige Film „The Professor and The Madman“ oder der Roman „The Dictionary of Lost Words“ von Pip Williams zeigen. Im Film geht es übrigens um den wohl berühmtesten Freiwilligen des Projekts, nämlich um den Mörder Dr. William Minor, der als Patient im Broadmoor Criminal Lunatic Asylum einsitzt und von dort aus Wörter einsendet. Dr. William Minor treffen wir auch in Sarah Ogilvies Publikation wieder.
Der Autorin bin ich witzigerweise auch während meines Lexikographiestudiums an der FAU Erlangen-Nürnberg begegnet. Im Jahr 2017 hielt sie an meiner Uni einen Vortrag zum Thema „Lexicography and Digital Humanities“. Es ging um die Frage, wie sich digitale Tools und Methoden auf die lexikographische Arbeit auswirken. Ich war von ihrer Arbeit fasziniert und ihr Vortrag hat mich weiter darin bestärkt, Lexikographin zu werden. Mit den Recherchen an diesem Buch hat sie im Jahr 2014 begonnen und ich frage mich, ob sie auch in Erlangen (oder Nürnberg) zu den Dictionary People recherchiert hat? Denn die Freiwilligen, die sich am OED mit Wort-Einsendungen beteiligten, kamen nicht nur aus England, sondern aus allen Teilen der Welt, somit auch aus Deutschland – leider habe ich im Buch keine direkte Erwähnung meiner Uni-Stadt entdecken können.
Ich war sehr aufgeregt, dieses Buch zu lesen, weil es eine ganz andere Perspektive auf die lexikographische Arbeit eröffnet, die ich aus meinem Studium und auch aus meinem Beruf als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Wörterbuchprojekt kenne. Meist werden Wörterbuchprojekte in akademischen Elfenbeintürmen erarbeitet, in der der Bezug zur breiten Öffentlichkeit (abgesehen von Social Media und Wissenschaftskommunikation) minimal ist oder gar fehlt. Studierte Akademiker*innen und Expert*innen spielen hier die Hauptrolle, was je nach Projekt auch nicht anders sein kann. Doch das OED war ein Gemeinschaftsprojekt und die Autorin erzählt von genau dieser Gemeinschaft, die das Wörterbuch zu etwas Besonderem gemacht hat. Die Analyse der Adressbücher ergab, dass sich um die 3000 Personen am OED beteiligt haben, indem sie Wörter und Zitate – also Belege für die Verwendung eines Wortes – einschickten. Nicht alle waren erfolgreiche oder nützliche Einsender*innen und ihre lebensweltlichen Hintergründe sind so divers wie kurios.
Die Struktur dieses Buches erinnert an das eines Wörterbuchs: Die Kapitelüberschriften folgen dem Alphabet. Jedem Buchstaben des Alphabets ist ein Thema zugeordnet, das den in dem Kapitel vorgestellten Personen entspricht. Bspw. lernt man im Kapitel A Archäolog*innen kennen, im Kapitel I Erfinder*innen („Inventors“) und im Kapitel Q queere Personen („Queers“) usw. Alleine schon diese Aufstellung zeig das breite Themenspektrum, das die Autorin abzudecken versucht. Und das bei 3000 Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Bandbreite der Themen und die hohe Anzahl von Personen sind des Buches Stärke und Schwäche zugleich. Denn es fehlte insgesamt ein roter Faden. Klar, ist es eine ehrenvolle Sache die Namen dieser Personen, die einen unverzichtbaren Beitrag zum Wörterbuch geleistet haben, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ob die Herangehensweise der Autorin dieser Aufgabe gewachsen ist? Darüber lässt sich streiten. Beeindruckend ist das Buch „The Dictionary People“ trotzdem.
Es ist natürlich sehr interessant zu erfahren, wer genau hinter einem Namen steckt und was diese Person in ihrem Leben geleistet hat. Die Autorin erzählt von manchen Personen nur sehr oberflächlich, von manches sehr ausführlich und manchmal findet man auf den Seiten nur eine Aufzählung von Namen – je nachdem wie viel sie über die entsprechenden Personen herausfinden konnte, variiert die Ausführlichkeit. Dabei entsteht so einige „Unordnung“ und einige Personen gehen in diesem Wust an Namen und Informationen einfach unter. Nur ein paar Personen und ihre Geschichten sind mir im Gedächtnis geblieben. Aber sollte ich jemals nachlesen wollen, welche Suffragisten, welche Kleptomanen oder Pornographiesammler am Wörterbuch mitgearbeitet haben, weiß ich, wo ich nachschauen kann. Es zeigt sich daran aber auch, dass es nicht so einfach ist, Menschen in Schubladen zu stecken: Dass sie vielleicht mit einem Bein in dem Themengebiet verankert sind, aber mit einer Hand nach einem anderen Interessensgebiet greifen. Diese Klassifikationsschwierigkeiten gibt die Autorin auch offen zu und weist immer wieder auf Überschneidungen zwischen den Themenkategorien hin.
Diese „Unordnung“ lässt sich am besten am Beispiel der Frauen erklären. Das W-Kapitel ist den Frauen („Women“) gewidmet. Insgesamt kommen auf die 3000 Personen 487 Frauen, die Wörter für das Projekt gesammelt und eingesendet haben. Für die damalige Zeit, die gerade erst die Geburt der ersten (weißen) Frauenbewegung erlebte, kann sich diese Zahl durchaus sehen lassen. Dennoch war das OED in seinen Anfängen ein mehrheitlich weißes und männliches Projekt (vor allem was die angestellten Wörterbuchmitarbeiter angeht). Anhand des Inhaltsverzeichnisses bin ich davon ausgegangen, dass alle weiblichen Freiwilligen in dem Frauen-Kapitel untergebracht sein würden. Daher war ich etwas überrascht, direkt im ersten Kapitel eine Archäologin kennenzulernen. Die Kapitelüberschrift war in diesem Fall also etwas fehlleitend. Denn natürlich waren Frauen zB auch Archäologinnen (obowhl das damals vielleicht nicht ganz so selbstverständlich war). Dabei ist es nur richtig, den Frauen, die eine klare Minderheit ausmachen, auch ein eigenes Kapitel zu widmen, um sie nochmal hervorzuheben. Gerade die Beteiligung der Frauen hätte mMn eine eigenständige Publikation sein können!
Für die Nachforschungen an diesem Buch hat sich die Autorin in Bibliotheken und Archive begeben und dennoch war ihre Suche nicht immer erfolgreich. Die Erzählung über die Dictionary People ist auch geprägt von Unbestimmtheit und Spekulationen. Nicht immer waren alle Identitäten auffindbar oder eindeutig bestimmbar. Ob alle Schlussfolgerungen der Autorin so stimmen, lässt sich nicht immer überprüfen. Bei manchen Geschichten bleibt einfach ein Hauch von Unsicherheit.
Die Autorin verarbeitet in ihrem Buch sehr viel Wissen und viele Kuriositäten, die das eigene, sprachbegeisterte Nerd-Herz höher schlagen lassen. Bei der Lektüre erfährt man auch einiges über die lexikographische Arbeit: Wie schreibt man ein Wörterbuch? Was spielt dabei eine Rolle? Es wird deutlich, dass Sprache menschengemacht ist und wie kulturelle und technologische Errungenschaften Sprache verändern und ergänzen können. Man erhält Einblick in die Wissenschaftslandschaft der damaligen Zeit zB erhalt man Einblick in die Rolle der zahllosen Societies, die die britische Forschung beeinflussten und regelten. Ich habe auch viele Bezüge zu meiner eigenen Arbeit herstellen können. Bspw. erwähnt die Autorin Wörterbücher, die ich bei meiner Arbeit nutze: das Wörterbuch der Brüder Grimm und das Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge, der Murray dreißig Jahre lang bei der Erarbeitung von Etymologien half. Da habe ich nicht schlecht gestaunt!
In diesem Buch steckt sehr viel Herzblut – dieses Buch war der Autorin ein besonderes Anliegen, in das sie sehr viel Zeit (8 Jahre!) und viele Ressourcen gesteckt hat. Das bleibt einem bei der Lektüre nicht verborgen. Und es ist genau diese Leidenschaft, die dazu beiträgt, dass die Namen zu Personen und zu lebendigen Geschichten werden.
Mein Fazit
„The Dictionary People” von Sarah Ogilvie ist ein außergewöhnliches Buch, das das Herz von Sprachbegeisterten höher schlagen lässt. Ausgehend von einem Adressbuch ist es der Autorin gelungen, den Namen und Adressen Gesichter und Geschichten zu geben, die eine ganz eigene Perspektive auf das monumentale Wörterbuchprojekt des OED eröffnen. Manchmal lohnt es sich, aus dem Elfenbeinturm herauszukommen. Absolute Leseempfehlung!